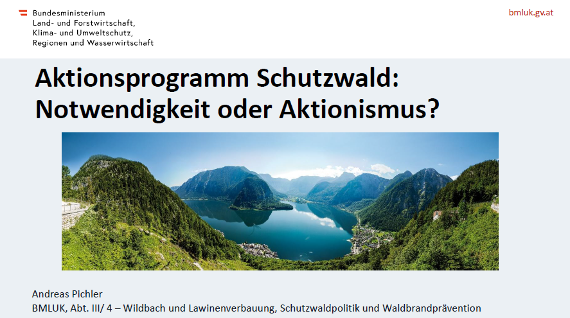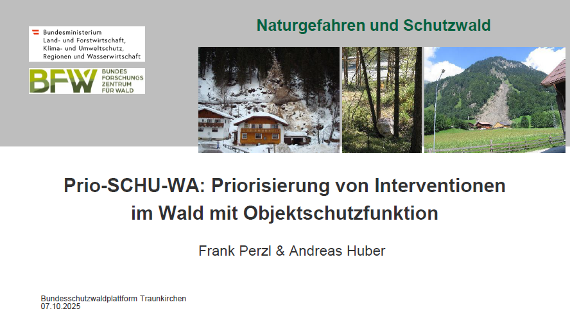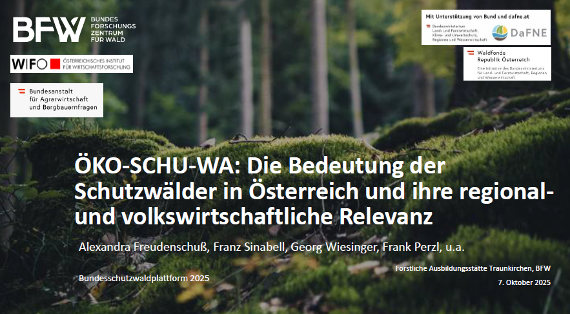Schutzwald im Gespräch
Die Bundesschutzwaldplattform 2025 ist die Leitveranstaltung des vom Forstwirtschaftsministerium initiierten Aktionsprogramms Schutzwald - „Wald schützt uns!“. Das fachpolitische „Gipfeltreffen“ fand am 7. und 8. Oktober 2025 im Rahmen des Österreichischen Walddialoges in Kooperation mit dem Schutzwaldzentrum und dem Österreichischen Schutzwaldverein am WALDCAMPUS Österreich in Traunkirchen erfolgreich statt.
Unter dem Motto „Schutzwald in Wert setzen: Nutzungs- und Bewirtschaftungskonflikte gemeinsam überwinden“ wurden fundierte Fachvorträge, eine aktive Beteiligung über World Cafés und eine hochkarätige Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Politik, Behörde, Eigentümervertretung, Wissenschaft, KLAR!-Regionen und Praxis durchgeführt.
Die mit rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut besuchte Veranstaltung bot in einem fachlich breit gefächerten Programm die Möglichkeit, die vielfältigen Themen rund um den Schutzwald anzusprechen sowie aktuelle Praxisentwicklungen, Impulse und Ideen für das eigene Umfeld mitzunehmen.
Ziele der Veranstaltung
Die Bundesschutzwaldplattform dient dem fachlichen Dialog und Vernetzungsaustausch unterschiedlichster Akteure. Das Forum hat heuer erstmalig ein neues Format angeboten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten aktiv Ihre Ideen und Visionen während der Veranstaltung beitragen. Neben Impulsvorträgen und Diskussionsrunden, konnten erstmalig mit den World-Cafés gezielt wichtige Themen angesprochen und diskutiert werden. Diese Möglichkeit der gemeinsamen Kommunikation wurde sehr intensiv von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern genutzt, um fachliche Schwerpunkte und Ergebnisse für den Schutzwald in Österreich zu erarbeiten.
WALDCAMPUS Österreich
Der WALDCAMPUS Österreich in Traunkirchen war als Veranstaltungsort - umgeben von zahlreichen Objektschutzwäldern des Salzkammerguts – prädestiniert, um den bundeweiten Dialog und das fachliche Netzwerken zum Thema Schutzwald zu unterstützen. Als wissenschaftliches und praxisorientiertes, nationales und internationales Aus- und Weiterbildungszentrum schafft der Standort einen profunden Fokus in der Lehre. Bundesminister Norbert Totschnig betonte in seinen Schlussworten, dass der WALDCAMPUS ein wichtiger Partner - für das von seinem Ressort initiierte Schutzwaldzentrum - ist. Schutzwaldbezogene Information, Beratung und Bewusstseinsbildung sind essentielle Elemente, die vom Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung gemeinsam mit den Kooperationspartnern dem Bundesforschungszentrum für Wald, der Universität für Bodenkultur Wien und der Österreichische Bundesforste AG forciert werden.
Themenschwerpunkte
Die diesjährige Veranstaltung stellte ganz gezielt den "Wert des Schutzwaldes" für die Gesellschaft in den Fokus der Aufmerksamkeit. Unter anderem wurden essentielle Themen angesprochen, wie die Herausforderungen in der Praxis, wissenschaftliche Erkenntnisse um den Schutzwald noch besser zu verstehen und die nachhaltige Waldbewirtschaftung dieser besonderen Wälder. Aber auch aktuelle Themen aus der nationalen Schutzwaldpolitik standen im Fokus. Dabei konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch die Gelegenheit nutzen und ihre Wünsche und Erwartungen an die zukünftige Schutzwaldpolitik einbringen.
Mit den Entwicklungsprojekten "ÖKO-SCHU-WA - Die Bedeutung der Schutzwälder in Österreich und ihre regional- und volkswirtschaftliche Relevanz" und "PRIO-SCHU-WA - Priorisierung von Interventionen im Wald mit Objektschutzfunktion" wurden Ergebnisse präsentiert, welche für die Praxis wichtige Erkenntnisse und lösungsorientierte Antworten gegen die Herausforderungen anbieten sollen.
Aktiver Dialog
Im Rahmen der Bundesschutzwaldplattform 2025 wurden in drei World Cafés zentrale Perspektiven rund um die Zukunft der Schutzwälder diskutiert. Unter der Leitung und Moderation einer betroffenen Gemeinde, Eigentümervertretung und eines Großbetriebes betrachteten diese dabei ihre spezifischen Herausforderungen – stets mit dem gemeinsamen Ziel, die Schutzfunktion des Waldes auch künftig zu sichern und Nutzungskonflikte konstruktiv zu lösen.
World Café 1. „Die Gemeinde“ im Spannungsfeld von Nutzungskonflikten im und um den Schutzwald – Herausforderungen und Lösungsansätze
Leitung: Bürgermeister Richard Unterreiner (Gemeinde Mörtschach, Kärnten)
Frage 1: Mit welchen Nutzungskonflikten und Herausforderungen hat sich eine Gemeinde mit einem hohen Schutzwaldanteil im ländlichen bzw. besiedelten Bereich nach massiven Waldverlusten durch Naturereignisse (Windwürfe, Schneebrüche, Borkenkäferkalamitäten etc.) auseinanderzusetzen?
Frage 2: Welche Lösungsansätze kann es von verschiedenen Institutionen geben, bzw. welche Institution ist verpflichtet, sich um mögliche Lösungsansätze zu kümmern?
Die Diskussion zeigte deutlich, dass Gemeinden häufig zwischen den Fronten stehen: Sie tragen Verantwortung für Sicherheit, Infrastruktur und Lebensqualität, verfügen aber oft über begrenzte finanzielle Mittel. Nach großflächigen Schadereignissen (z.B. VAIA Sturmkatastrophe aus dem Jahr 2018) sehen sich betroffene Regionen mit steigendem Druck konfrontiert – Wiederbewaldung, Hangstabilisierung und Gefahrenprävention müssen für die regionale Bevölkerung bewältigt werden, während gleichzeitig wirtschaftliche Nutzung und Naturschutzinteressen aufeinandertreffen. Als zentrale Lösungswege wurden Kooperation und klare Zuständigkeiten hervorgehoben: Nur durch abgestimmtes Handeln von Gemeinde, Forstbehörden, Eigentümerinnen und Eigentümern und Förderstellen kann Schutzwaldbewirtschaftung langfristig gesichert werden. Ebenso wichtig sind Transparenz, Kommunikation und Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung, um Verständnis und Unterstützung für notwendige Maßnahmen zu schaffen.
World Café 2. „Was bedeuten die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Eigentümerinnen und Eigentümer von Schutzwäldern?“
Leitung: DI Valerie Lainer-Findeis (Land&Forst Betriebe Österreich – Forst & Umwelt, Projekte, Bildung)
Frage 1: In welchen gesetzlichen Rahmen bewegen sich Eigentümer und Bewirtschafter von Schutzwäldern? Welche Einflüsse oder Zielkonflikte können zwischen den Bestimmungen des Forstgesetzes und weiteren, den Wald betreffenden Gesetzen entstehen?
Frage 2: Welche Bedeutung haben die gesetzlichen Vorgaben für Eigentumsrechte?
Im Mittelpunkt dieses World Cafés stand die rechtliche und wirtschaftliche Verantwortung der Waldeigentümerinnen und Waldeigentümern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer betonten, dass der Schutzwald durch das Forstgesetz zwar klar definierten Verpflichtungen unterliegt, etwa zur Erhaltung seiner Schutzfunktion (z.B. Wiederaufforstung, Forstschutz), diese Vorgaben in der Praxis aber oft mit hohen Kosten und bürokratischem Aufwand verbunden sind. Zielkonflikte ergeben sich zudem aus der Überschneidung verschiedener Rechtsbereiche – etwa zwischen Forst-, Umwelt- und Raumordnungsgesetzgebung. Diskutiert wurde, dass Schutzwalderhaltung als öffentliches Interesse anerkannt ist aber auch stärker von Betroffenen/Begünstigten unterstützt werden sollte. Mehr Rechtssicherheit, einfachere Verfahren und verlässliche Förderinstrumente wurden als wesentliche Hebel genannt, um Eigentümerinnen und Eigentümern zu entlasten und nachhaltige Bewirtschaftung zu ermöglichen.
World Café 3. „Praxis live aus einem Großbetrieb: Betriebswirtschaftliche Herausforderungen und zukünftige Chancen“
Leitung: Dipl.-Forstw. Hellen David (Österreichische Bundesforste AG)
Frage 1: Wie kann der Schutzwald fit für die Zukunft gemacht werden und wie können die notwendigen Maßnahmen finanziert werden?
Frage 2: Inwieweit und unter welchen Rahmenbedingungen kann Schutzwald unter Schutz gestellt werden? Oder ist es effektiver, ihn bewusst nachhaltig zu bewirtschaften, damit er seine Schutzfunktion auch in Zukunft erfüllen kann?
Aus Sicht des Großbetriebes wurde deutlich, dass der Klimawandel die Bewirtschaftung massiv beeinflusst: Sturmschäden, Trockenheit und Schädlinge fordern enorme Anpassungsleistungen. Der Schutzwald muss widerstandsfähiger, vielfältiger und klimafit gestaltet werden. Neben ökologischen Überlegungen standen hier betriebswirtschaftliche Aspekte im Fokus: Wie können Investitionen in Schutzmaßnahmen langfristig abgesichert werden, und welche neuen Geschäftsmodelle oder Förderwege sind dafür notwendig? Diskutiert wurde auch, dass eine bewusste, nachhaltige Bewirtschaftung oft effektiver ist als eine formale Unterschutzstellung, denn aktive Pflege, gezielte Baumartenwahl und moderne Technik sichern die Schutzfunktion nachhaltig und anpassungsfähig. Innovation, Digitalisierung und Kooperation mit Gemeinden, Jagdbehörde und Forschungseinrichtungen wurden als Zukunftsstrategien betont.
Fazit aus den World Cafés
Die drei World Cafés zeigten eindrucksvoll, dass die Herausforderungen rund um den Schutzwald vielschichtig, aber lösbar sind – wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Gemeinden, Eigentümerinnen und Eigentümer und Klein- bis Großbetriebe stehen vor unterschiedlichen, doch eng miteinander verknüpften Aufgaben: rechtliche Klarheit, finanzielle Absicherung, fachliche Unterstützung und gesellschaftliche Wertschätzung.
Ein gemeinsames Fazit lautete: Ausschließlich ein gesunder, stabiler und resilienter Schutzwald kann seine Ökosystemleistungen erfüllen und einen Wert für die Gesellschaft haben. Herausforderungen können nur durch Kooperation, Innovation und verlässliche Rahmenbedingungen gelöst werden damit seine Schutzfunktion auch für kommende Generationen erhalten bleiben.
Alle Akteure waren sich einig, dass gerade die Bewusstseinsbildung und öffentliche Kommunikation zur Förderung der „grünen Infrastruktur“ Schutzwald ein wesentliches Instrument darstellen um Fragestellungen mit starken Antworten zu begegnen.
Zusammenfassende Ergebnisse aus der Podiumsdiskussion
Die Bundesschutzwaldplattform 2025 stand ganz im Zeichen des gemeinsamen Engagements für den Erhalt, die Pflege und die Zukunft der österreichischen Schutzwälder. Den "Schutzwald in Wert setzen", ist eine prioritäre Botschaft für die Gesellschaft.
Ein zentrales Ergebnis der Plattform war die Einigkeit darüber, dass der Schutzwald nicht nur Herausforderungen hat, sondern diese als Chance zur Umwandlung von klimafitten Schutzwäldern gesehen werden müssen. Katastrophenereignisse wie Stürme, Schneebrüche oder Borkenkäferkalamitäten zeigen zwar die Verletzlichkeit dieser Wälder, eröffnen aber gleichzeitig Möglichkeiten, durch gezielte Maßnahmen die Naturverjüngung zu fördern, überalterte Bestände zu verjüngen und den Wald klimaresilient zu gestalten. Die Teilnehmenden waren sich einig: Aus Krisen kann Zukunft entstehen – wenn Wissen, Verantwortung und innovative Ideen zusammenkommen.
Um die Bedeutung des Schutzwaldes stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, wurde die Initiierung einer breit angelegten Werbe- und Informationskampagne empfohlen. Ziel ist es, die Leistungen des Schutzwaldes – vom Lawinenschutz bis zur Biodiversität – sichtbar zu machen und Wertschätzung in der Gesellschaft zu verankern. Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung sollen gezielt ausgebaut werden, insbesondere durch Bildungs- und Jugendinitiativen, um schon früh das Verständnis für die zentrale Rolle des Waldes zu fördern.
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Aus- und Weiterbildung: Fachkräfte, Gemeinden und Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer benötigen aktuelles Wissen, um auf neue Herausforderungen – etwa Klimawandel, geänderte Förderbedingungen oder neue technische Möglichkeiten – reagieren zu können. Der Ausbau praxisnaher Weiterbildungsangebote und der Erfahrungsaustausch zwischen Regionen sollen gezielt unterstützt werden. Dabei soll das Schutzwaldzentrum und seine Kooperationspartner eine wesentliche Rolle einnehmen.
Auch die finanzielle Basis des Schutzwaldes war Thema: Investitionen und Förderungen müssen langfristig und verlässlich gestaltet werden, um nachhaltige Bewirtschaftung zu ermöglichen. Dies muss auch der Politik klar sein. Nur so kann gewährleistet werden, dass Schutzwälder nicht nur Kostenfaktor, sondern auch wirtschaftlich tragfähiger Bestandteil der Forstwirtschaft bleiben. Gleichzeitig soll der Schutzwald wieder verstärkt in Ertrag gebracht werden – im Sinne einer nachhaltigen Nutzung, die Schutzfunktion und Wirtschaftlichkeit verbindet.
Ein besonderer Gedanke war die Wiederbelebung der Schutzwaldgemeinden, wie sie in der Vergangenheit erfolgreich bestanden haben. Solche lokalen Netzwerke können als Multiplikatoren wirken, Verantwortung bündeln und regionale Zusammenarbeit stärken. Ebenso wurde betont, dass Betroffene im Schutzwald stärker einbezogen werden müssen – von privaten Eigentümer:innen über Landnutzer:innen bis hin zu Gemeinden und Bürger:innen.
Als entscheidend gilt auch die "Einbindung regionaler Kümmerer" wie zum Beispiel der KLAR!-Managerinnen und Manager (Klimawandel-Anpassungsregionen), die vor Ort als Schnittstelle zwischen Praxis, Verwaltung und Bevölkerung fungieren können. Diese regionalen Akteure sollen künftig eine noch aktivere Rolle bei Planung, Kommunikation und Umsetzung von Schutzwaldprojekten übernehmen.
Ein Thema, das ebenfalls auf großes Interesse stieß, war die Jagd im Schutzwald. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprachen sich dafür aus, Konflikte offen anzusprechen und gemeinsam mit der Jägerschaft nach Lösungen zu suchen, um eine nachhaltige Schutzwaldverjüngung sicherzustellen.
Abschließend wurde die Veranstaltung selbst als einzigartiges Format gewürdigt: engagiert, praxisnah und von einer außergewöhnlich konstruktiven Atmosphäre geprägt. Die Bundesschutzwaldplattform 2025 zeigte, dass mit Fachwissen, Leidenschaft und Visionen viele Akteure an der Zukunft des Schutzwaldes arbeiten. Sie alle tragen dazu bei, dass der Schutzwald auch künftig seine vielfältigen Funktionen erfüllen kann.
Österreichische Schutzwaldpolitik
Mit dem Aktionsprogramm Schutzwald – „Wald schützt uns!“ konnten bereits eine Vielzahl an essentiellen Meilensteinen für den Erhalt und Verbesserung der Schutzwälder umgesetzt werden. Im Regierungsprogramm 2025–2029 wurde explizit die Fortführung und langfristige Weiterentwicklung dieser forstpolitischen Strategie festgelegt.
In der Videobotschaft für die Bundesschutzwaldplattform 2025 hat Forstwirtschaftsminister Norbert Totschnig darauf hingewiesen, dass die Schutzwaldthematik ein wesentlicher Grundpfeiler in der Österreichischen Waldpolitik ist.
Auch in Zukunft soll das Format der Bundesschutzwaldplattform als Informations- und Netzwerkknotenpunkt einen prioritären Beitrag für die Kommunikation und Bewusstseinsbildung in der Schutzwaldpolitik darstellen. Denn nur „Gemeinsam“ kann der Schutzwald in Österreich gestärkt und die Zukunft dieser Wälder positiv gestaltet werden.
Exkursion in den Schutzwald
Am zweiten Tag der Bundesschutzwaldplattform fand eine Exkursion in den Schutzwald statt. Ein vollständiger Exkursionsbericht (Artikel: Woche des Schutzwaldes 2025: Exkursion im Bannwald Grünberg und Großhangrutschung Gschliefgraben) vom 8. Oktober 2025 ist hier abrufbar.

SimoneSteurer.jpg/jcr:content/251007_Bundesschutzwaldtagung2025_01_(c)SimoneSteurer.jpg)



SimoneSteurer.jpg/jcr:content/251007_Bundesschutzwaldtagung2025_20_(c)SimoneSteurer.jpg)



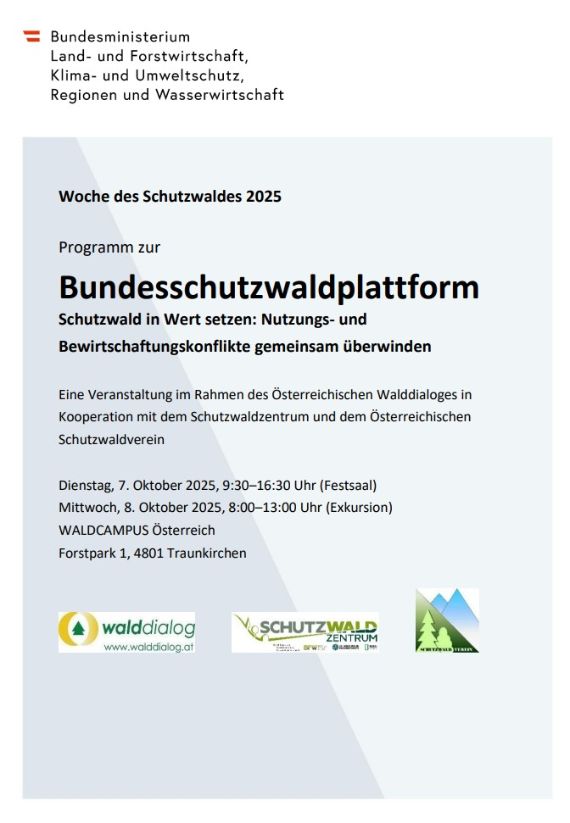
SimoneSteurer.jpg/jcr:content/251007_Bundesschutzwaldtagung2025_01_(c)SimoneSteurer.jpg)