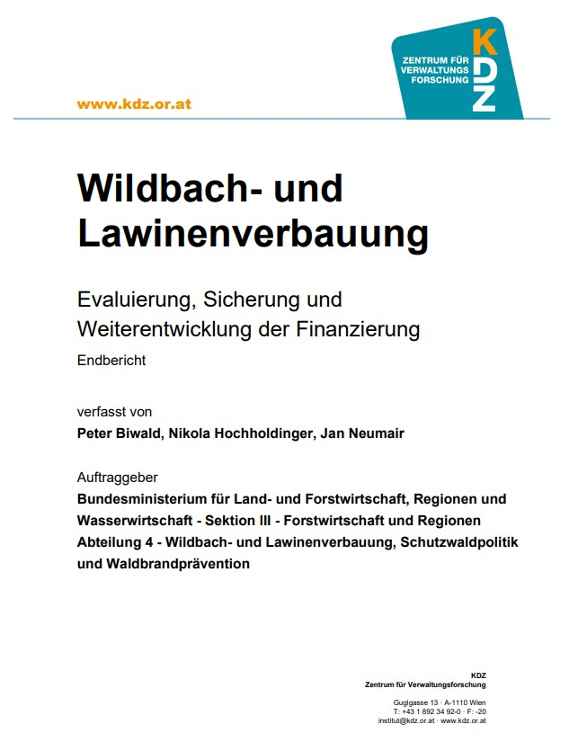Das KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung wurde damit beauftragt, den Zusammenhang zwischen der finanziellen Situation der Gemeinden und ihrer Gefährdung durch Wildbäche und Lawinen zu analysieren.
WLV-Gemeindefinanzstudie
Gemeinsam mit den Bundesländern, Gemeinden und anderen Finanzierungspartnerinnen und -partnern finanziert der Bund jährlich über 800 Baufelder der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV). Gemeinsam tragen die Finanzierungspartner:innen so zu einem verbesserten Schutz der Bevölkerung bei. Mit dem Ziel der Aktualisierung und Verbesserung des Finanzierungsmodells für diese Schutzmaßnahmen wurde das KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung beauftragt den Zusammenhang zwischen der finanziellen Situation der Gemeinden und ihrer Gefährdung durch Wildbäche und Lawinen zu analysieren.
Innerhalb des gültigen Rechtsrahmens soll dadurch die evidenzbasierte Grundlage geschaffen werden, Schutzmaßnahmen effizienter zu finanzieren und Österreichs Gemeinden besser bei der Erfüllung ihres Schutzauftrags gegenüber der Bevölkerung zu unterstützen.
Analyse der Gemeinden
Durch die Analyse von budgetären, demographischen, geographischen und wirtschaftlichen Daten aus dem Jahr 2022 zeigt der Bericht einige statistische Dependenzen auf, die neue Anhaltspunkte für die Fördermodelle geben. Zusätzlich zur Datenauswertung wurden Interviews mit Fachleuten und Beteiligten geführt.
Die Finanzanalyse der Gemeinden zeigt insbesondere folgende Ergebnisse:
- Die WLV-Gemeinden verfügen über eine geringere Finanzstärke als die Nicht-WLV-Gemeinden.
Als WLV-Gemeinde gilt eine Gemeinde, für die ein GZP erarbeitet wurde. - Die freie Finanzspitze ist bei den kleinen Gemeinden (bis 2.500 EW) niedriger als bei den größeren Gemeinden wie auch im Vergleich zu den Nicht-WLV-Gemeinden (bis 2.500 EW).
- Die Verschuldungsdauer ist mit der steigenden Einwohnerzahl rückläufig und steigt erst wieder bei den großen Städten ab 50.000 EW an.
- Gemeinden mit höherem Anteil an Personen in roten Gefahrenzonen haben eine schwächere Finanzkraft und kleinere freie Finanzspitze, eine höhere Verschuldung sowie eine höhere Netto-Belastung für Hochwasser- und Lawinenschutz als Gemeinden mit geringerem Gefährdungspotenzial.
- Der Tourismus zeigt bei kleineren Gemeinden in alpinen Lagen mit extrem hoher Gefährdung eine kompensatorische Wirkung, sodass diese Gemeinden finanziell vergleichsweise gut ausgestattet sind. Er ist eine Möglichkeit für gefährdete Gemeinden, aus eigener Kraft die systemisch bedingte Finanzschwäche auszugleichen.
- Die Vorbelastungen aus laufenden WLV-Projekten sind in Gemeinden bis 1.000 EW doppelt bis dreifach so hoch wie der Durchschnitt. Gemeinden mit einem großen Volumen solcher Vorbelastungen weisen eine kleinere freie Finanzspitze auf.
- Die Gemeindefinanzprognose bis 2027 zeigt eine durchgehende Verringerung der finanziellen Spielräume, die alle Größenklassen betrifft.
Modelle für die Bestimmung des Bundesanteils
Der Bericht erarbeitet auf dieser breiten Grundlage an Informationen fünf Modelle für die Bestimmung des angemessenen Bundesanteils bei der kollektiven Finanzierung von Schutzmaßnahmen und beleuchtet ihre Vor- und Nachteile im Lichte aktueller Herausforderungen. Während das derzeitige Finanzierungsmodell ein hohes Maß an Flexibilität gewährleistet, zeichnen sich Modelle, die auf messbaren Indikatoren beruhen, wie Punktemodelle und gemischte Modelle, durch Objektivität, Transparenz und geringere Verhandlungskosten aus.
Erkenntnisse des Berichts
In den Schlussfolgerungen werden auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse wichtige Fragestellungen herausgearbeitet, die im Mittelpunkt der weiteren Diskussion stehen sollten. Es wird dargestellt, welche Modelle jeweils wo ihre Stärken und Schwächen haben und die Anforderungen der WLV am besten erfüllen können. Es folgen abschließend Vorschläge, die sich aus verschiedensten Aspekten der Datenanalyse und den Interviews ergaben und kurze Denkanstöße zum Mindset der WLV, Informationsmanagement, Investitionsmanagement, Prozessmanagement und Fixkostenmanagement.